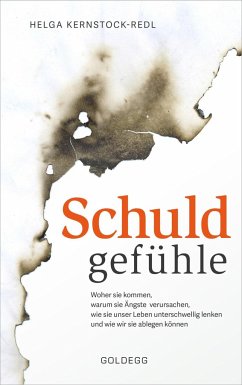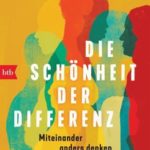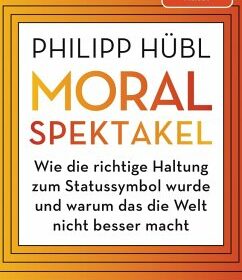Man kann wegen anderer schuldig werden
Eine echte Wahl braucht das Wissen um mögliche Folgen der einzelnen Alternativen. Fahrlässigkeit bedeutet zum Beispiel, nicht genug aufgepasst oder sich nicht informiert zu haben, obwohl man die Möglichkeit beziehungsweise die Pflicht dazu gehabt hätte. Helga Kernstock nennt ein Beispiel: „Wir alle müssen daher einer Operation im Wissen um das Risiko zustimmen und sie somit frei wählen – und entlasten damit das chirurgische Team von einer möglichen Schuld bei Komplikationen.“ Menschen können jedoch nicht wissen, was sie nicht wissen können. Doch das kann man dem Schuldsuchprogramm des Gehirns nur schwer erklären, das unbedingt Kausalzusammenhänge und Mitschuld samt Kontrollillusionen finden will. Genau deshalb ist die Frage nach der Wahlmöglichkeit ein enorm wichtiger Punkt bei der Prüfung von Schuldgefühlen. Helga Kernstock-Redl ist Psychologin und Psychotherapeutin. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Psychologie der Gefühlswelt.
Erwachsene haben die volle Verantwortung für sich selbst
Sobald eine andere Person, für die man von Rechts wegen Verantwortung hat, ein Gesetzt übertritt, zu Schaden kommt oder Schaden verursacht, kann man ebenfalls schuldig werden. Vorgesetzte tragen teilweise Verantwortung für die Leistung ihrer Mitarbeiter, Politiker für ihre Ressorts. Ausbilder haften vielleicht für die Aktionen von Auszubildenden und Eltern für ihre Kinder. Gesetze und Verträge geben das manchmal so eindeutig vor. Öfter jedoch bestimmen gesellschaftliche Normen, gewachsene Traditionen oder innerfamiliäre, anerzogene Regeln, wer wofür Verantwortung hat und eventuell die Schuld übernehmen muss.
In der psychologischen Arbeit gilt es zunächst zu klären, wer wofür Verantwortung hat. Helga Kernstock-Redl empfiehlt grundsätzlich, davon auszugehen, dass Erwachsene die volle Verantwortung für sich und das eigene Verhalten zu übernehmen haben. Weil Gefühle in einem Menschen manchmal unvermutet auftauchen, gilt Helga Kernstock-Redls Erfahrung nach: „Wir sind nicht schuld daran, was wir fühlen. Doch wir sind voll verantwortlich dafür, was wir mit einem Gefühl tun, ob wir ihm folgen, ob wir es verstärken oder aktiv schwächer machen, indem wir den Futterkreislauf unterbrechen.“
Es gibt eine Rangreihung im Sinne eines „höherwertigen Rechtsguts“
Wer sich Geld ausleiht, muss es zurückzahlen, und wer sich vertraglich verpflichtet, eine bestimmte Leistung zu erbringen, ist schuldig, das auch zu tun. Helga Kernstock-Redl stellt fest: „Der Inhalt einer solchen Vereinbarung muss natürlich der Person, die sich dafür entscheidet, vorher bekannt sein und auch sonst die Kriterien einer echten Wahl erfüllen.“ Juristisch gesehen ist dieser Faktor also einfach. Bei Geschenken ist die Sache schon schwieriger. Also hat der Gesetzgeber das genau definieren müssen.
Es gibt Umstände, durch die eine Person „im Recht“ sein kann, obwohl sie eigentlich ein Gesetz missachtet. Eine der wichtigsten davon ist die Rangreihung im Sinne eines „höherwertigen Rechtsgut“. Der Schutz des Lebens zählt zum Beispiel mehr als der Schutz von Gütern. Rechte können ebenfalls Schuld eindämmen. Bei Gewalt gibt es den Begriff der angemessenen Notwehr, denn man darf sich bei einem verbalen Angriff verbal, bei einem körperlichen Angriff durchaus gewaltsam schützen. Quelle: „Schuldgefühle“ von Karin Kernstock-Redl
Von Hans Klumbies